ZÜRICH – Jeder hat seine ureigenen Ängste und jede Angst entsteht im Gehirn. Die neue Sonderausstellung im Zoologischen Museum der Universität Zürich erklärt eindrücklich, wie Angst entsteht, wie sie Mensch und Tier eigen ist, uns mobilisiert, aber auch, wie Angst uns krank machen kann. Die Ausstellung „Keine Panik! Tierisch Angst im Gehirn“ soll dazu beitragen, dass wir diese Emotion verstehen und besser mit ihr umgehen können.Sie öffnete am 26. August ihre Türen.
Eine Sirene ertönt, der Lift bleibt stecken – Herzrasen, stockender Atem und feuchte Hände stellen sich ein. Der Körper schlägt Alarm, weil Ohren und Augen Signale ans Gehirn weitergeleitet haben. Denn Angst entsteht im Gehirn. Dies erfahren Besucherinnen und Besucher des Zoologischen Museums der Universität Zürich gleich zu Beginn der Ausstellung „Keine Panik! Tierisch Angst im Gehirn“. Im Eingang zur Ausstellung befinden sie sich bereits inmitten von Nervenzellen, die das Angstnetzwerk abbilden. Anhand von zehn interaktiven Stationen und mit eindrücklichen Beispielen auf Deutsch, Französisch und Englisch erklärt die von den Universitäten Genf und Zürich lancierte Ausstellung die biologischen Grundlagen einer unserer Grundemotionen.
Auch Tausende von Tierarten kennen dieses unangenehme Gefühl der Angst. Ihre Angstreaktionen sind den unseren sehr ähnlich, wie ein ausgestelltes „Angsttotem“ zeigt: Angst führt in der Tierwelt zu stereotypen Verhaltensweisen, beispielsweise zum Aufschrecken, Angriff, zur Flucht oder zum Erstarren. So ist beispielsweise ein Opossum in der Lage, sich totzustellen. Ein Video zeigt die schauspielerische Parforceleistung dieses Tiers, das sich auf den Boden fallen lässt, sobald ein Hund näher kommt. „Angst ist auch ein tierisches Phänomen und hilft sowohl dem Individuum, als auch der ganzen Gruppe zu überleben“, resümiert Isabel Klusman, die die Ausstellung in Zürich verantwortet, an der Medienführung. Angst fungiert für Mensch und Tier als Warnsystem, das uns rechtzeitig auf Gefahren hinweist und mobilisiert.
Fortwährende Angst kann Tiere genauso wie Menschen krank machen. Angsterkrankungen gehören zu den meist verbreiteten psychischen Krankheiten. In der Schweiz leiden zwischen 100.000 und 250.000 Menschen etwa an Panikstörungen. Angststörungen entstehen aus einer Mischung von genetischer Veranlagung und externen Faktoren – eine Zusammensetzung, die bei jedem Menschen anders ist. Dies gilt auch für Phobien, die sich im Unterschied zu anderen Angststörungen auf ein Objekt, Tier oder eine ganz bestimmte Situation, wie das Fliegen, beziehen. „Angststörungen und Phobien entstehen mehrheitlich in der Kindheit“, erklärt Michael Rufer, Professor für Psychosoziale Medizin, Psychosomatik und Psychotherapie der Universität Zürich. Die schrittweise Konfrontation mit einem Angstobjekt, können Kinder und Erwachsene in der Ausstellung gleich an typischen Angstobjekten, wie einer Spinne, ausprobieren. Nachgestellte Situationen, beispielsweise jene zur Sozialphobie, veranschaulichen, wie man das Gefühl bekommt, den Urteilen, der Kritik und dem Spott anderer Menschen ausgeliefert zu sein.
Angst kann sich vom Stolperstein bis zur Behinderung im Alltag entwickeln: Von einer generalisierten Angststörung betroffen, brüten Personen über Dinge und haben negative Gedanken, die in Katastrophenszenarien enden, sodass für sie schliesslich alles und jedes zu einem Objekt der Angst wird. „Trotzdem lassen sich Angststörungen im Vergleich mit anderen psychischen Erkrankungen besonders gut behandeln“, hält Michael Rufer fest. „Und glücklicherweise verstehen neurowissenschaftliche Forschende heute zunehmend besser, wie die biologischen Mechanismen der unterschiedlichen Angststörungen funktionieren“. Betroffene können dank bewährten therapeutischen Ansätzen wie der kognitiven Verhaltenstherapie, Entspannungstechniken und pharmazeutischen Präparaten zur Erhöhung der Angstschwelle den Weg zurück zu einem angenehmeren Leben finden.
LEIPZIG – Nicht nur die Fähigkeiten eines Zahnmediziners zählen, wenn der Patient zur Behandlung zu ihm kommt. Auch die Praxis muss einen ...
BERN – Mundgeruch ist ein Tabuthema. Etwa ein Viertel der Bevölkerung leidet gelegentlich unter Mundgeruch. Die Schweizerische ...
CHAPEL HILL, USA – Triclosan ist ein antimikrobieller Wirkstoff, der häufig in Kosmetika oder Desinfektionsmitteln vorkommt. Eine neue Studie zeigt ...
LEIPZIG - In dieser Live-OP am 5. August ab 15 Uhr zum Thema „Sofortimplantation – Konzept zur Schaffung eines natürlichen Emergenzprofils“ zeigt Dr....
ZÜRICH – Der Zahnarztberuf ist längst keine Männerdomäne mehr. Rund ein Drittel aller Hochschulabsolventen ist weiblich. Um ...
GENF – Die Klinik für Kariologie und Endodontologie der Universität Genf hat im Februar 2015 unter der Leitung von Prof. Dr. Ivo Krejci das ...
BERN – Am vergangenen Wochenende fand im Kongresszentrum Kursaal Bern eine Premiere statt: Der erste Fachkongress zur Alterszahnmedizin in der ...
BERN – Die ästhetische Zahnmedizin kennt professionelle Verfahren, verfärbte Zähne aufzuhellen, das sogenannte ...
BAD HOMBURG VOR DER HÖHE – Aktuell wird davon ausgegangen, dass jedes siebte Kind in Deutschland von einer Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation (MIH) ...
GENF – Am weltweiten Mundhygienetag (World Oral Health Day, WOHD) veröffentlichte der Weltverband der Zahnärzte (World Dental Federation, FDI) die ...
Live-Webinar
Di. 24. Februar 2026
19:00 Uhr (CET) Zurich
Prof. Dr. Markus B. Hürzeler
Live-Webinar
Di. 24. Februar 2026
21:00 Uhr (CET) Zurich
Prof. Dr. Marcel A. Wainwright DDS, PhD
Live-Webinar
Mi. 25. Februar 2026
14:00 Uhr (CET) Zurich
Live-Webinar
Mi. 25. Februar 2026
17:00 Uhr (CET) Zurich
Prof. Dr. Daniel Edelhoff
Live-Webinar
Mi. 25. Februar 2026
19:00 Uhr (CET) Zurich
Live-Webinar
Do. 26. Februar 2026
2:00 Uhr (CET) Zurich
Live-Webinar
Fr. 27. Februar 2026
14:00 Uhr (CET) Zurich
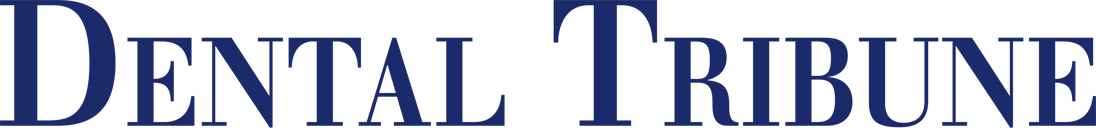


 Österreich / Österreich
Österreich / Österreich
 Bosnien und Herzegowina / Босна и Херцеговина
Bosnien und Herzegowina / Босна и Херцеговина
 Bulgarien / България
Bulgarien / България
 Kroatien / Hrvatska
Kroatien / Hrvatska
 Tschechien & Slowakei / Česká republika & Slovensko
Tschechien & Slowakei / Česká republika & Slovensko
 Frankreich / France
Frankreich / France
 Deutschland / Deutschland
Deutschland / Deutschland
 Griechenland / ΕΛΛΑΔΑ
Griechenland / ΕΛΛΑΔΑ
 Ungarn / Hungary
Ungarn / Hungary
 Italien / Italia
Italien / Italia
 Niederlande / Nederland
Niederlande / Nederland
 Nordic / Nordic
Nordic / Nordic
 Polen / Polska
Polen / Polska
 Portugal / Portugal
Portugal / Portugal
 Rumänien & Moldawien / România & Moldova
Rumänien & Moldawien / România & Moldova
 Slowenien / Slovenija
Slowenien / Slovenija
 Serbien & Montenegro / Србија и Црна Гора
Serbien & Montenegro / Србија и Црна Гора
 Spanien / España
Spanien / España
 Schweiz / Schweiz
Schweiz / Schweiz
 Türkei / Türkiye
Türkei / Türkiye
 Großbritannien und Irland / UK & Ireland
Großbritannien und Irland / UK & Ireland
 International / International
International / International
 Brasilien / Brasil
Brasilien / Brasil
 Kanada / Canada
Kanada / Canada
 Lateinamerika / Latinoamérica
Lateinamerika / Latinoamérica
 USA / USA
USA / USA
 China / 中国
China / 中国
 Indien / भारत गणराज्य
Indien / भारत गणराज्य
 Pakistan / Pākistān
Pakistan / Pākistān
 Vietnam / Việt Nam
Vietnam / Việt Nam
 ASEAN / ASEAN
ASEAN / ASEAN
 Israel / מְדִינַת יִשְׂרָאֵל
Israel / מְדִינַת יִשְׂרָאֵל
 Algerien, Marokko und Tunesien / الجزائر والمغرب وتونس
Algerien, Marokko und Tunesien / الجزائر والمغرب وتونس
 Naher Osten / Middle East
Naher Osten / Middle East





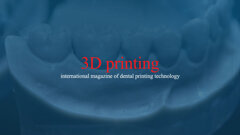
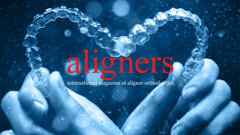











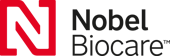











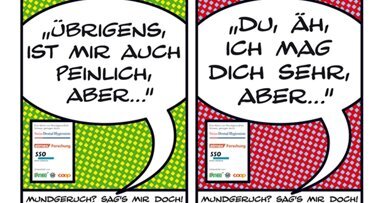










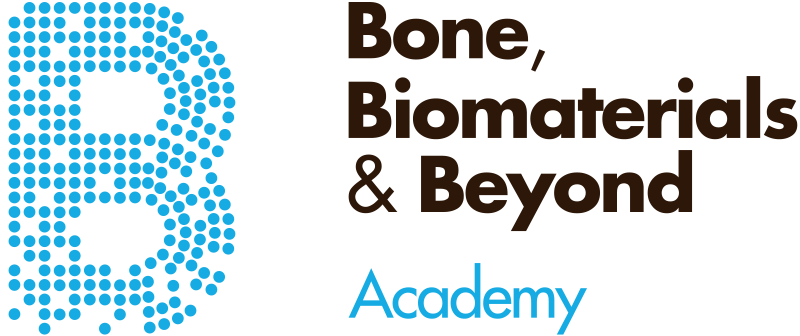

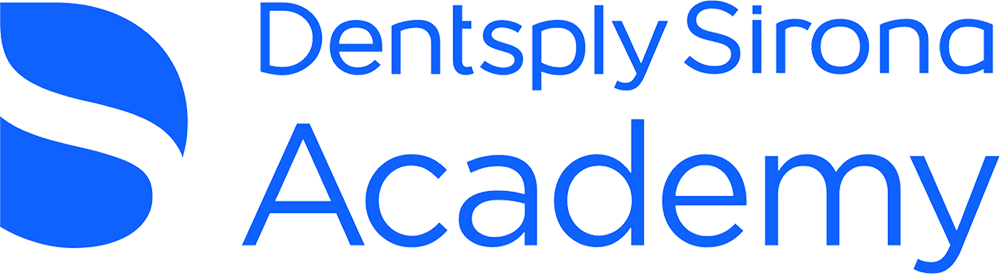













To post a reply please login or register