ZÜRICH – Prof. Dr. Ivo Krejci referierte an einer msd-forum-Veranstaltung am 3. Dezember im Zürcher Marriott-Hotel. An den Beginn seines Vortrages stellte er das eher trockene Thema, das er aber äusserst spannend vermittelte: Theoretische Betrachtungen zur Lichtpolymerisation.
Es gibt über 2.000 wissenschaftliche Artikel zu diesem Thema – er empfahl den Zuhörern unter www.pubmed.com die Stichwörter „light curing“ oder „light polymerisation“ einzugeben – wobei eines immer wieder auftaucht: Lichtpolymerisation ist sehr häufig defizitär, dies ist jedoch klinisch nicht immer auf den ersten Blick erkennbar. Ein kritischer Punkt für alle Polymerisationslampen ist eine ausreichende Energiedosis – oft wird Leistung und Energie verwechselt. Diese wird in Joules (Energie) angegeben und entspricht der Wattzahl (Leistung) pro Sekunde, bezogen auf die Fläche in cm2. So ist heute allgemein akzeptiert, dass zur Lichtpolymerisation etwa 16 Joules/cm2 nötig sind, d.h. 20 Sekunden bei 800 mW, 10 Sekunden bei 1.600 mW. Nach den Grundlagen stieg Prof. Krejci in die praktische Anwendung der Polymerisationslampen nach heutigem Wissensstand ein.
Polymerisationslampen der dritten Generation
Aber leider ist Polymerisation nicht beliebig verkürzbar, da die chemische Reaktion Zeit braucht. Ebenfalls spielt die Durchhärtungstiefe eine Rolle. Dabei ist auch entscheidend, dass die Polymerisationsleuchte absolut ruhig gehalten sowie ein perfektes Lichtspektrum emittiert wird. Dabei ist auch der Einfluss der Kompositopazität (Farbpigmente) zu berücksichtigen. So empfiehlt der Referent eine Sicherheitsmarge, die auch bei Lampen mit hoher Energie bei einer Härtezeit von 20 Sekunden liegt. Die Polymerisationslampen der neusten (3.) Generation regen nicht nur den Standardfotoinitiator Kampherchinon an, sondern auch weitere Photoinitiatoren, die heute mehr und mehr in Gebrauch kommen, um die Eigenschaften des Komposits zu verbessern. Diese neuen LED-Leuchten sind nach Ansicht des Referenten allen anderen Härtelampen überlegen, vor allen Dingen dann, wenn diese eine gute Lichtbündelung (Kollimation) zeigen. Hier gibt es leider grosse Unterschiede und die Lampen mit Glaslichtleiter zeigen da keine optimalen Werte. Stabförmige LED-Leuchten mit einem guten Linsensystem sind hier deutlich überlegen und weisen auch noch andere Vorteile auf, die da wären: Besseres Handling und ein besserer Zugang.
Weiterhin haben Härteleuchten mit integriertem Akku, die aber auch direkt angeschlossen werden können, viele praktische Vorteile, aber auch eine Reihe von Nachteilen, die einen Einfluss auf die Qualität der Lichthärtung haben können.
Die perfekte Fissurenversiegelung
Prof. Krejci empfiehlt, auf die klassische Fissurenversiegelung mit dünnfliessenden Fissurenversieglern zu verzichten. Für ihn sind Fissurenversiegelungen kleine Füllungen, die entsprechend sorgfältig durchgeführt und mit entsprechenden Komposits verschlossen werden sollten. „Eine Fissurenversiegelung ist nur dann sinnvoll, wenn sie perfekt gemacht wird“, betonte der Referent. Generell konnte Prof. Krejci zeigen, dass fliessfähige Komposits deutlich stärker schrumpfen, immer noch zu viel Stress generieren und deshalb obsolet sind. Als Möglichkeit, die Fliessfähigkeit der hochgefüllten Komposits zu verbessern, empfiehlt er, diese vor der Applikation zu erwärmen.
Praktische Demonstrationen am Modell
Der Vortrag war gespickt mit praktischen Informationen. Im Rahmen einer praktischen Demonstration zeigte Prof. Krejci am Modell einige Tipps und Tricks zur Matrizentechnik bei tiefliegenden approximalen Kavitäten. Auch grössere Rekonstruktionen im Seitenzahnbereich können mit adhäsiv verankerten Kompositrestaurationen ausgeführt werden. Auch bei den indirekt hergestellten Restaurationen konnten Langzeitstudien zeigen, dass die Kompositrekonstruktionen den keramischen Rekonstruktionen nicht unterlegen sind.
Ein rundherum spannender Fortbildungsabend, gespickt mit Wissenschaft, praktischen Empfehlungen und einem echten State of the Art Update zum Thema.
LEIPZIG – Obwohl das Polymerisieren mit Licht ein alltäglicher, häufiger Arbeitsgang in jeder zahnärztlichen Praxis ist, wird ihm oft ...
LEIPZIG – Laute Bohrergeräusche, komische Gerüche und vor allem Schmerzen: Besonders negative Erfahrungen münden nicht selten in der ...
Madrid – Im Jahr 2019 litten weltweit über 3,6 Milliarden Menschen an Erkrankungen der Mundhöhle, mehr als an Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ...
Bern – Der Ende September vom Bundesrat kommunizierte Anstieg der Krankenkassenprämien verdeutlicht erneut, dass die laufenden Reformen im ...
München – Ob im Darm, im Mund oder auf der Haut: Der Körper ist von verschiedenen, meist nützlichen Bakterien besiedelt, deren Zusammensetzung sich in ...
Genf – Die 78. Tagung der Weltgesundheitsversammlung fand vom 19. bis 27. Mai 2025 in Genf unter dem Motto «Eine Welt für Gesundheit» statt.
LIVERPOOL, ENGLAND – Claire Embleton aus Liverpool tat es den ganzen Tag über ohne die geringste Ahnung, dass es ihr schaden könnte. ...
LEIPZIG – Zahnaufhellungen werden immer beliebter und somit auch zu einem wichtigeren Thema für Zahnmediziner. Der DT Study Club präsentiert...
Betriebswirtschaftliche Themen stossen bei Zahnärzten zunehmend auf Interesse. Jedenfalls verzeichnete das von der Zahnärztekasse AG in Luzern, ...
BERN – Aus dem Jahr 1994 stammt der gleichnamige oscarprämierte Kultfilm von Quentin Tarantino – und genau 20 Jahre später ludt ...
Live-Webinar
Di. 24. Februar 2026
19:00 Uhr (CET) Zurich
Prof. Dr. Markus B. Hürzeler
Live-Webinar
Di. 24. Februar 2026
21:00 Uhr (CET) Zurich
Prof. Dr. Marcel A. Wainwright DDS, PhD
Live-Webinar
Mi. 25. Februar 2026
14:00 Uhr (CET) Zurich
Live-Webinar
Mi. 25. Februar 2026
17:00 Uhr (CET) Zurich
Prof. Dr. Daniel Edelhoff
Live-Webinar
Mi. 25. Februar 2026
19:00 Uhr (CET) Zurich
Live-Webinar
Do. 26. Februar 2026
2:00 Uhr (CET) Zurich
Live-Webinar
Fr. 27. Februar 2026
14:00 Uhr (CET) Zurich
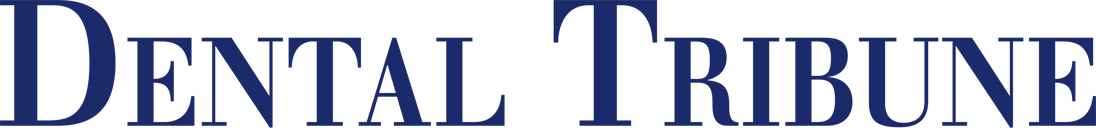


 Österreich / Österreich
Österreich / Österreich
 Bosnien und Herzegowina / Босна и Херцеговина
Bosnien und Herzegowina / Босна и Херцеговина
 Bulgarien / България
Bulgarien / България
 Kroatien / Hrvatska
Kroatien / Hrvatska
 Tschechien & Slowakei / Česká republika & Slovensko
Tschechien & Slowakei / Česká republika & Slovensko
 Frankreich / France
Frankreich / France
 Deutschland / Deutschland
Deutschland / Deutschland
 Griechenland / ΕΛΛΑΔΑ
Griechenland / ΕΛΛΑΔΑ
 Ungarn / Hungary
Ungarn / Hungary
 Italien / Italia
Italien / Italia
 Niederlande / Nederland
Niederlande / Nederland
 Nordic / Nordic
Nordic / Nordic
 Polen / Polska
Polen / Polska
 Portugal / Portugal
Portugal / Portugal
 Rumänien & Moldawien / România & Moldova
Rumänien & Moldawien / România & Moldova
 Slowenien / Slovenija
Slowenien / Slovenija
 Serbien & Montenegro / Србија и Црна Гора
Serbien & Montenegro / Србија и Црна Гора
 Spanien / España
Spanien / España
 Schweiz / Schweiz
Schweiz / Schweiz
 Türkei / Türkiye
Türkei / Türkiye
 Großbritannien und Irland / UK & Ireland
Großbritannien und Irland / UK & Ireland
 International / International
International / International
 Brasilien / Brasil
Brasilien / Brasil
 Kanada / Canada
Kanada / Canada
 Lateinamerika / Latinoamérica
Lateinamerika / Latinoamérica
 USA / USA
USA / USA
 China / 中国
China / 中国
 Indien / भारत गणराज्य
Indien / भारत गणराज्य
 Pakistan / Pākistān
Pakistan / Pākistān
 Vietnam / Việt Nam
Vietnam / Việt Nam
 ASEAN / ASEAN
ASEAN / ASEAN
 Israel / מְדִינַת יִשְׂרָאֵל
Israel / מְדִינַת יִשְׂרָאֵל
 Algerien, Marokko und Tunesien / الجزائر والمغرب وتونس
Algerien, Marokko und Tunesien / الجزائر والمغرب وتونس
 Naher Osten / Middle East
Naher Osten / Middle East





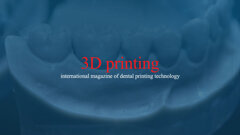
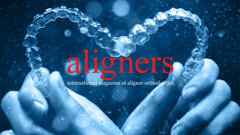






























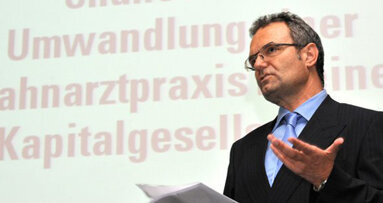



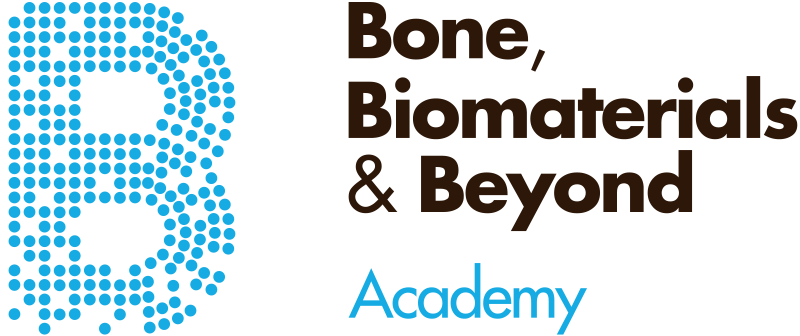

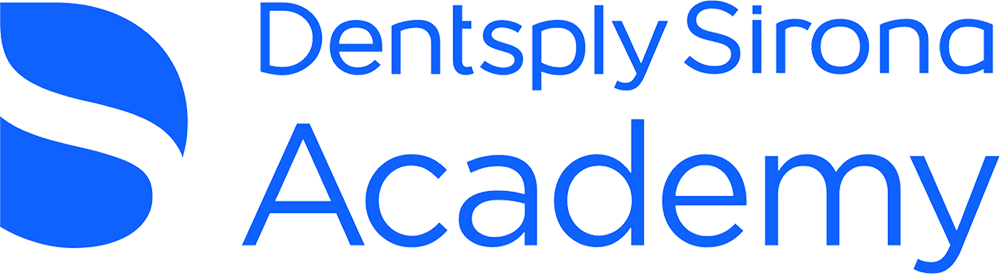













To post a reply please login or register